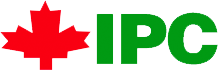Anbieter von Energierückkopplungseinheiten für Frequenzumrichter weisen darauf hin, dass einige Industrieunternehmen aufgrund der Umsetzung von Richtlinien und der intensiven Förderung der Frequenzumrichtertechnologie sowie der starken Marketingaktivitäten von Anbietern von Frequenzumrichtern den Einsatz von Frequenzumrichtern unbewusst mit Energieeinsparung und Stromsparen gleichsetzen. In der Praxis zeigt sich jedoch aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten, dass nicht überall, wo Frequenzumrichter eingesetzt werden, Energie und Strom eingespart werden können. Woran liegt das und welche Missverständnisse bestehen in der Öffentlichkeit bezüglich Frequenzumrichtern?
Irrtum 1: Die Verwendung eines Frequenzumrichters kann Strom sparen
In einigen Publikationen wird behauptet, Frequenzumrichter seien energiesparende Steuerungsprodukte, wodurch der Eindruck entsteht, dass man durch den Einsatz von Frequenzumrichtern Strom sparen kann.
Frequenzumrichter sparen Strom, weil sie die Drehzahl von Elektromotoren regeln können. Sind Frequenzumrichter energiesparende Steuerungsprodukte, so gelten alle Drehzahlregler als solche. Der Frequenzumrichter ist nur geringfügig effizienter und hat einen niedrigeren Leistungsfaktor als andere Drehzahlregler.
Ob ein Frequenzumrichter Energieeinsparungen ermöglicht, hängt von den Drehzahlregelungseigenschaften seiner Last ab. Bei Lasten wie Radialventilatoren und Kreiselpumpen ist das Drehmoment proportional zum Quadrat der Drehzahl und die Leistung proportional zur dritten Potenz der Drehzahl. Solange die ursprüngliche Ventilsteuerung genutzt wird und der Betrieb nicht unter Volllast erfolgt, kann durch Umstellung auf Drehzahlregelung Energie eingespart werden. Sinkt die Drehzahl auf 80 % des Ausgangswerts, beträgt die Leistung nur noch 51,2 % des Ausgangswerts. Der Einsatz von Frequenzumrichtern bei solchen Lasten hat somit einen signifikanten Energiespareffekt. Bei Lasten wie Roots-Gebläsen ist das Drehmoment drehzahlunabhängig, es handelt sich also um eine Last mit konstantem Drehmoment. Wird die ursprüngliche Methode der Luftmengenregulierung mittels Entlüftungsventil durch Drehzahlregelung ersetzt, lässt sich auch hier Energie einsparen. Sinkt die Drehzahl auf 80 % des Ausgangswerts, erreicht die Leistung ebenfalls 80 % des Ausgangswerts. Der Energiespareffekt ist jedoch deutlich geringer als bei Radialventilatoren und Kreiselpumpen. Bei Konstantleistungslasten ist die Leistung unabhängig von der Drehzahl. Eine Konstantleistungslast in einem Zementwerk, wie beispielsweise eine Dosierbandwaage, verringert die Banddrehzahl bei dicker Materialschicht unter bestimmten Fließbedingungen; bei dünner Materialschicht erhöht sie sich. Der Einsatz von Frequenzumrichtern führt bei solchen Lasten nicht zu einer Energieeinsparung.
Gleichstrommotoren weisen im Vergleich zu Gleichstrom-Drehzahlregelungssystemen einen höheren Wirkungsgrad und Leistungsfaktor als Wechselstrommotoren auf. Der Wirkungsgrad digitaler Gleichstrom-Drehzahlregler ist mit dem von Frequenzumrichtern vergleichbar und sogar etwas höher. Daher ist die Behauptung, dass der Einsatz von Wechselstrom-Asynchronmotoren und Frequenzumrichtern mehr Strom spart als der Einsatz von Gleichstrommotoren und Gleichstromreglern, weder theoretisch noch praktisch, falsch.
Irrtum 2: Die Kapazitätsauswahl des Frequenzumrichters basiert auf der Nennleistung des Motors.
Im Vergleich zu Elektromotoren sind Frequenzumrichter teurer, daher ist es sehr sinnvoll, die Kapazität der Frequenzumrichter angemessen zu reduzieren und gleichzeitig einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Die Leistung eines Frequenzumrichters bezieht sich auf die Leistung des 4-poligen Wechselstrom-Asynchronmotors, für den er geeignet ist.
Da Motoren gleicher Leistung unterschiedliche Polzahlen aufweisen, variiert ihr Nennstrom. Mit steigender Polzahl erhöht sich auch der Nennstrom. Die Auslegung des Frequenzumrichters darf daher nicht allein auf der Nennleistung des Motors basieren. Auch bei Sanierungsprojekten, die ursprünglich keine Frequenzumrichter vorsahen, ist die Auslegung nicht allein auf den Nennstrom des Motors beschränkt. Denn bei der Auslegung von Elektromotoren müssen Faktoren wie Last, Leistungsreserve und Motorspezifikationen berücksichtigt werden. Oftmals ist die Leistungsreserve hoch, und Industriemotoren arbeiten mit 50 bis 60 % ihrer Nennlast. Würde die Auslegung des Frequenzumrichters allein auf dem Nennstrom des Motors basieren, entstünde eine zu große Reserve, was zu unnötigen Kosten und einer verminderten Zuverlässigkeit führen würde.
Bei Kurzschlussläufermotoren sollte die Auslegung des Frequenzumrichters so erfolgen, dass dessen Nennstrom mindestens dem 1,1-Fachen des maximalen Normalbetriebsstroms des Motors entspricht. Dadurch lassen sich die Kosten maximieren. Unter bestimmten Bedingungen, wie z. B. Anlauf unter hoher Last, hohen Umgebungstemperaturen, bei Motoren mit Schleifringwicklung oder Synchronmotoren, ist eine entsprechende Erhöhung der Umrichterleistung erforderlich.
Bei Anlagen, die von Anfang an Frequenzumrichter verwenden, ist es nachvollziehbar, die Umrichterkapazität anhand des Nennstroms des Motors zu wählen. Dies liegt daran, dass die Umrichterkapazität zu diesem Zeitpunkt nicht anhand der tatsächlichen Betriebsbedingungen bestimmt werden kann. Um die Investitionskosten zu reduzieren, kann die Umrichterkapazität in manchen Fällen zunächst unbestimmt bleiben und erst nach einer gewissen Betriebsdauer anhand des tatsächlichen Stroms angepasst werden.
In der Sekundärmahlanlage einer Zementmühle (2,4 m Durchmesser × 13 m) eines Zementwerks in der Inneren Mongolei ist ein hocheffizienter Pulverselektor vom Typ N-1500 O-Sepa aus chinesischer Produktion im Einsatz. Dieser ist mit einem Elektromotor vom Typ Y2-315M-4 (132 kW) ausgestattet. Es wurde jedoch ein Frequenzumrichter vom Typ FRN160-P9S-4E gewählt, der für 4-polige Motoren mit 160 kW Leistung ausgelegt ist. Nach der Inbetriebnahme beträgt die maximale Betriebsfrequenz 48 Hz und der Strom lediglich 180 A, also weniger als 70 % des Nennstroms des Motors. Der Motor selbst weist eine erhebliche Überkapazität auf. Die Spezifikationen des Frequenzumrichters sind zudem eine Stufe höher als die des Antriebsmotors, was zu unnötigem Energieverlust führt und die Zuverlässigkeit nicht verbessert.
Das Zuführsystem des Kalksteinbrechers Nr. 3 im Zementwerk Anhui Chaohu verwendet einen Plattenaufgeber (1500 × 12000 mm). Der Antriebsmotor ist ein Wechselstrommotor vom Typ Y225M-4 mit einer Nennleistung von 45 kW und einem Nennstrom von 84,6 A. Vor der Umrüstung auf Frequenzumrichter-Drehzahlregelung wurde im Normalbetrieb des Plattenaufgebers festgestellt, dass der durchschnittliche Drehstrom nur 30 A beträgt, also lediglich 35,5 % des Nennstroms des Motors. Um Kosten zu sparen, wurde der Frequenzumrichter ACS601-0060-3 mit einem Nennausgangsstrom von 76 A ausgewählt. Dieser eignet sich für 4-polige Motoren mit einer Leistung von 37 kW und erzielt eine gute Performance.
Diese beiden Beispiele verdeutlichen, dass bei Sanierungsprojekten, bei denen ursprünglich keine Frequenzumrichter eingesetzt wurden, die Wahl der Kapazität des Frequenzumrichters auf Basis der tatsächlichen Betriebsbedingungen die Investitionskosten erheblich reduzieren kann.
Irrtum 3: Verwendung der visuellen Leistung zur Berechnung der Blindleistungskompensation und der Energieeinsparungsvorteile
Berechnen Sie die Energieeinsparung durch Blindleistungskompensation anhand der Scheinleistung. Bei Volllastbetrieb des Lüfters mit Netzfrequenz beträgt der Betriebsstrom des Motors 289 A. Bei Verwendung einer frequenzgeregelten Drehzahlregelung liegt der Leistungsfaktor bei Volllastbetrieb mit 50 Hz bei etwa 0,99, und der Strom bei 257 A. Dies ist auf den internen Filterkondensator des Frequenzumrichters zurückzuführen, der den Leistungsfaktor verbessert. Die Energieeinsparung berechnet sich wie folgt: ΔS = UI = 380 × (289 - 257) = 21 kVA
Daher wird angenommen, dass der Energiespareffekt etwa 11 % der Kapazität einer einzelnen Maschine beträgt.
Tatsächliche Analyse: S steht für die Scheinleistung, das Produkt aus Spannung und Stromstärke. Bei gleicher Spannung sind die prozentuale Scheinleistungseinsparung und die prozentuale Stromeinsparung identisch. In einem Stromkreis mit Reaktanz spiegelt die Scheinleistung lediglich die maximal zulässige Ausgangsleistung des Verteilungssystems wider und gibt nicht die tatsächliche Leistungsaufnahme des Motors wieder. Die tatsächliche Leistungsaufnahme des Elektromotors kann nur als Wirkleistung ausgedrückt werden. In diesem Beispiel wird zwar die Wirkleistung, aber nicht die Wirkleistung, berechnet, obwohl die tatsächliche Stromstärke für die Berechnung verwendet wird. Bekanntermaßen hängt die tatsächliche Leistungsaufnahme eines Elektromotors vom Lüfter und seiner Last ab. Die Erhöhung des Leistungsfaktors veränderte weder die Last des Lüfters noch verbesserte sie dessen Wirkungsgrad. Die tatsächliche Leistungsaufnahme des Lüfters sank daher nicht. Nach der Erhöhung des Leistungsfaktors blieben der Betriebszustand des Motors, der Statorstrom und die aufgenommene Wirk- und Blindleistung unverändert. Der Anstieg des Leistungsfaktors ist darauf zurückzuführen, dass der interne Filterkondensator des Frequenzumrichters Blindleistung erzeugt, die dem Motor zugeführt wird. Mit steigendem Leistungsfaktor sinkt der tatsächliche Eingangsstrom des Frequenzumrichters, wodurch die Leitungsverluste zwischen Stromnetz und Frequenzumrichter sowie die Kupferverluste des Transformators reduziert werden. Gleichzeitig können die Verteilanlagen wie Transformatoren, Schalter, Schütze und die den Frequenzumrichter versorgenden Leitungen aufgrund des sinkenden Laststroms höhere Lasten aufnehmen. Es ist anzumerken, dass bei Nichtberücksichtigung der Einsparungen durch reduzierte Leitungs- und Transformatorverluste, wie in diesem Beispiel, sondern ausschließlich der Verluste des Frequenzumrichters selbst, dieser bei Volllast und 50 Hz nicht nur keine Energie einspart, sondern sogar Strom verbraucht. Daher ist die Berechnung von Energieeinsparungen anhand der Scheinleistung nicht korrekt.
Der Radialventilator eines Zementwerks wird vom Typ Y280S-4 angetrieben und hat eine Nennleistung von 75 kW, eine Nennspannung von 380 V und einen Nennstrom von 140 A. Vor der Umrüstung auf Frequenzumrichter-Drehzahlregelung war das Ventil vollständig geöffnet. Tests ergaben einen Motorstrom von 70 A bei nur 50 % Last, einen Leistungsfaktor von 0,49, eine Wirkleistung von 22,6 kW und eine Scheinleistung von 46,07 kVA. Nach der Umrüstung auf Frequenzumrichter-Drehzahlregelung beträgt der durchschnittliche Strom im Drehstromnetz bei vollständig geöffnetem Ventil und Nenndrehzahl 37 A. Daraus ergibt sich eine Energieeinsparung von (70 - 37) ÷ 70 × 100 % = 44,28 %. Diese Berechnung mag plausibel erscheinen, basiert aber im Grunde weiterhin auf der Scheinleistung. Nach weiteren Tests stellte das Werk einen Leistungsfaktor von 0,94, eine Wirkleistung von 22,9 kW und eine Scheinleistung von 24,4 kVA fest. Es zeigt sich, dass eine Erhöhung der Wirkleistung nicht nur keine Energieeinsparung, sondern sogar einen höheren Energieverbrauch zur Folge hat. Der Grund für den Anstieg der Wirkleistung liegt darin, dass die Verluste des Frequenzumrichters berücksichtigt wurden, nicht jedoch die Einsparungen durch reduzierte Leitungs- und Transformatorverluste. Der entscheidende Fehler besteht darin, dass der Einfluss eines erhöhten Leistungsfaktors auf den Stromabfall nicht beachtet wurde und der Standardleistungsfaktor unverändert blieb. Dadurch wurde der Energiespareffekt des Frequenzumrichters überbewertet. Daher muss bei der Berechnung des Energiespareffekts die Wirkleistung anstelle der Scheinleistung verwendet werden.
Irrtum 4: Schütze können nicht auf der Ausgangsseite des Frequenzumrichters installiert werden.
Nahezu alle Bedienungsanleitungen für Frequenzumrichter weisen darauf hin, dass Schütze nicht auf der Ausgangsseite des Frequenzumrichters installiert werden dürfen. So heißt es beispielsweise in der Bedienungsanleitung des japanischen Yaskawa-Frequenzumrichters: „Schließen Sie keine elektromagnetischen Schalter oder elektromagnetischen Schütze an den Ausgangskreis an.“
Die Herstellervorgaben verhindern, dass der Schütz anspricht, wenn der Frequenzumrichter Strom liefert. Wird der Frequenzumrichter im Betrieb an eine Last angeschlossen, aktiviert sich aufgrund des Leckstroms der Überstromschutz. Um sicherzustellen, dass der Schütz nur dann anspricht, wenn der Frequenzumrichter keinen Strom liefert, kann er ausgangsseitig installiert werden, sofern zwischen dem Ausgang des Frequenzumrichters und dem Schütz entsprechende Verriegelungen vorhanden sind. Diese gewährleisten, dass der Schütz nur dann anspricht, wenn der Frequenzumrichter keinen Strom liefert. Dieses System ist besonders vorteilhaft, wenn nur ein Frequenzumrichter und zwei Motoren vorhanden sind (ein Motor im Betrieb und ein Reservemotor). Bei einer Störung des laufenden Motors kann der Frequenzumrichter einfach auf den Reservemotor umschalten und diesen nach einer kurzen Verzögerung automatisch in den Frequenzumrichterbetrieb versetzen. So lässt sich auch die gegenseitige Absicherung beider Elektromotoren realisieren.
Irrtum 5: Der Einsatz von Frequenzumrichtern in Radialventilatoren kann die Regelklappe des Ventilators vollständig ersetzen.
Die Drehzahlregelung eines Radialventilators mittels Frequenzumrichter zur Steuerung des Luftvolumenstroms bietet im Vergleich zur Regelung über Regelventile eine erhebliche Energieeinsparung. In manchen Fällen kann der Frequenzumrichter das Ventil des Ventilators jedoch nicht vollständig ersetzen, weshalb bei der Konstruktion besondere Sorgfalt geboten ist. Um dies zu verdeutlichen, betrachten wir zunächst das Energiesparprinzip: Der Luftvolumenstrom eines Radialventilators ist proportional zur Potenz seiner Drehzahl, der Luftdruck proportional zum Quadrat seiner Drehzahl und die Wellenleistung proportional zur dritten Potenz seiner Drehzahl.
Die Kennlinie des Ventilators in Abhängigkeit von Luftdruck und Volumenstrom (HQ) bei konstanter Drehzahl ist in Kurve (2) dargestellt. Diese Kennlinie zeigt den Luftwiderstand des Rohrleitungsnetzes (Ventil vollständig geöffnet). Im Betriebspunkt A beträgt der Luftvolumenstrom Q1. Die Wellenleistung N1 ist in diesem Fall proportional zum Produkt aus Fläche und H1 (AH1OQ1). Sinkt der Luftvolumenstrom von Q1 auf Q2, ändert sich bei Anwendung der Ventilverstellung die Widerstandskennlinie des Rohrleitungsnetzes gemäß Kurve (3). Das System arbeitet nun vom ursprünglichen Betriebspunkt A zum neuen Betriebspunkt B, wobei der Winddruck ansteigt. Die Wellenleistung N2 ist proportional zur Fläche (BH2OQ2), und N1 unterscheidet sich kaum von N2. Bei Anwendung der Drehzahlregelung sinkt die Ventilatordrehzahl von n1 auf n2, und die Kennlinie des Luftvolumenstroms (HQ) ist in Kurve (4) dargestellt. Bei gleichem Luftvolumen Q2 sinkt der Winddruck H3 deutlich, und die Leistung N3 (entspricht der Fläche CH3OQ2) sinkt deutlich, was auf einen signifikanten Energiespareffekt hinweist.
Aus der obigen Analyse geht hervor, dass bei der Steuerung des Luftvolumenstroms über ein Ventil mit sinkendem Luftvolumenstrom der Luftdruck tatsächlich steigt. Bei der Steuerung des Luftvolumenstroms über einen Frequenzumrichter hingegen sinkt der Luftdruck mit sinkendem Luftvolumenstrom deutlich. Ein zu starker Druckabfall kann die Prozessanforderungen unter Umständen nicht erfüllen. Liegt der Betriebspunkt innerhalb des Bereichs zwischen Kurve (1), Kurve (2) und der H-Achse, reicht die alleinige Drehzahlregelung über einen Frequenzumrichter nicht aus, um die Prozessanforderungen zu erfüllen. Hier ist eine Kombination mit einer Ventilregelung erforderlich. Der von einem bestimmten Hersteller eingesetzte Frequenzumrichter für Radialventilatoren führte aufgrund mangelnder Ventilauslegung und der ausschließlichen Nutzung der Drehzahlregelung über den Frequenzumrichter zur Änderung des Betriebspunktes des Ventilators zu erheblichen Problemen. Entweder war die Drehzahl zu hoch oder der Luftvolumenstrom zu groß. Wird die Drehzahl reduziert, reicht der Winddruck nicht mehr für die Prozessanforderungen aus, und die Luftzufuhr ist unzureichend. Daher müssen bei der Verwendung eines Frequenzumrichters zur Drehzahlregelung und Energieeinsparung bei Radialventilatoren sowohl Luftvolumenstrom als auch Luftdruck berücksichtigt werden, da es sonst zu unerwünschten Folgen kommt.
Irrtum 6: General-Motoren können nur mit reduzierter Drehzahl unter Verwendung eines Frequenzumrichters unterhalb ihrer Nenndrehzahl betrieben werden.
Die klassische Theorie besagt, dass die obere Grenzfrequenz eines Universalmotors bei 55 Hz liegt. Dies liegt daran, dass bei einer Drehzahl oberhalb der Nenndrehzahl die Statorfrequenz (50 Hz) ansteigt. Wird in diesem Fall weiterhin das Prinzip des konstanten Drehmoments angewendet, übersteigt die Statorspannung die Nennspannung. Daher muss die Statorspannung bei Drehzahlen oberhalb der Nenndrehzahl konstant auf dem Nennwert gehalten werden. Mit steigender Drehzahl bzw. Frequenz sinkt der magnetische Fluss, wodurch das Drehmoment bei gleichem Statorstrom abnimmt, die mechanischen Eigenschaften des Motors nachlassen und die Überlastfähigkeit stark reduziert wird.
Daraus lässt sich schließen, dass die obere Grenze der Frequenz eines Universalmotors 55 Hz beträgt, was eine Voraussetzung ist:
1. Die Statorspannung darf die Nennspannung nicht überschreiten;
2. Der Motor läuft mit Nennleistung;
3. Konstante Drehmomentbelastung.
In der oben beschriebenen Situation haben Theorie und Experimente gezeigt, dass bei einer Frequenz von über 55 Hz das Motordrehmoment abnimmt, die mechanischen Eigenschaften nachlassen, die Überlastfähigkeit sinkt, der Eisenverbrauch rapide ansteigt und es zu starker Erwärmung kommt.
Generell lässt sich die Drehzahl von Allzweckmotoren durch Frequenzumrichter erhöhen. Ist eine Drehzahlsteigerung durch variable Frequenz möglich? Um wie viel? Dies hängt maßgeblich von der Last des Elektromotors ab. Zunächst muss die Lastrate ermittelt werden. Anschließend müssen die Lastcharakteristika analysiert und Berechnungen auf Basis der spezifischen Lastsituation durchgeführt werden. Eine kurze Analyse folgt:
1. Tatsächlich ist es bei einem 380-V-Universalmotor möglich, ihn über einen längeren Zeitraum mit einer Statorspannung von über 10 % der Nennspannung zu betreiben, ohne dass die Isolation oder die Lebensdauer des Motors beeinträchtigt wird. Die Statorspannung steigt, das Drehmoment erhöht sich deutlich, der Statorstrom sinkt und die Wicklungstemperatur nimmt ab.
2. Die Auslastung des Elektromotors beträgt üblicherweise 50 % bis 60 %.
Industriemotoren arbeiten üblicherweise mit 50 % bis 60 % ihrer Nennleistung. Berechnungen zufolge sinkt der Statorstrom um 26,4 %, wenn die Ausgangsleistung des Motors 70 % der Nennleistung beträgt und die Statorspannung um 7 % steigt. Selbst bei konstanter Drehmomentregelung und einer Drehzahlerhöhung des Motors um 20 % mittels Frequenzumrichter bleibt der Statorstrom in diesem Fall konstant und sinkt sogar. Obwohl der Eisenverbrauch des Motors nach der Frequenzerhöhung stark ansteigt, ist die dadurch entstehende Wärme im Vergleich zur durch den sinkenden Statorstrom reduzierten Wärme vernachlässigbar. Daher sinkt auch die Temperatur der Motorwicklung deutlich.
3. Es gibt verschiedene Lastcharakteristika.
Das elektrische Antriebssystem versorgt die Last, wobei unterschiedliche Lasten unterschiedliche mechanische Eigenschaften aufweisen. Elektromotoren müssen nach der Beschleunigung die Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften der Last erfüllen. Berechnungen zufolge ist die maximal zulässige Betriebsfrequenz (f<sub>max</sub>) für Lasten mit konstantem Drehmoment bei verschiedenen Lastwechselraten (k) umgekehrt proportional zur Lastwechselrate, d. h. f<sub>max</sub> = f<sub>e</sub>/k, wobei f<sub>e</sub> die Nennfrequenz ist. Bei Lasten mit konstanter Leistung wird die maximal zulässige Betriebsfrequenz von Motoren im Allgemeinen hauptsächlich durch die mechanische Festigkeit von Rotor und Welle begrenzt. Der Autor empfiehlt, diese im Allgemeinen auf maximal 100 Hz zu begrenzen.
Irrtum 7: Vernachlässigung der inhärenten Eigenschaften von Frequenzumrichtern
Die Inbetriebnahme des Frequenzumrichters wird üblicherweise vom Vertriebspartner durchgeführt, sodass keine Probleme auftreten. Die Installation eines Frequenzumrichters ist relativ einfach und wird in der Regel vom Anwender selbst vorgenommen. Manche Anwender lesen die Bedienungsanleitung des Frequenzumrichters jedoch nicht sorgfältig genug, halten sich nicht strikt an die technischen Anforderungen für die Installation, ignorieren die Eigenschaften des Frequenzumrichters selbst, verwechseln ihn mit herkömmlichen elektrischen Bauteilen und handeln nach Gefühl und Erfahrung, wodurch sie versteckte Gefahren für Fehler und Unfälle riskieren.
Gemäß der Bedienungsanleitung des Frequenzumrichters sollte das an den Motor angeschlossene Kabel ein geschirmtes oder armiertes Kabel sein, vorzugsweise in einem Metallrohr verlegt. Die Kabelenden sollten möglichst sauber abgeschnitten, die ungeschirmten Abschnitte so kurz wie möglich und die Kabellänge auf maximal 50 m begrenzt sein. Bei großen Kabelabständen zwischen Frequenzumrichter und Motor kann der hohe Oberwellen-Ableitstrom des Kabels den Frequenzumrichter und umliegende Geräte beeinträchtigen. Die vom Motor zurückgeführte Erdungsleitung muss direkt an den entsprechenden Erdungsanschluss des Frequenzumrichters angeschlossen werden. Die Erdungsleitung des Frequenzumrichters darf nicht mit Schweißgeräten oder anderen elektrischen Anlagen gemeinsam genutzt werden und sollte so kurz wie möglich sein. Aufgrund des vom Frequenzumrichter erzeugten Ableitstroms kann ein zu großer Abstand zum Erdungspunkt zu instabilen Potenzialverhältnissen am Erdungsanschluss führen. Der Mindestquerschnitt der Erdungsleitung des Frequenzumrichters muss mindestens dem Querschnitt des Netzkabels entsprechen. Um Fehlfunktionen durch Störungen zu vermeiden, sollten Steuerkabel verdrillte oder doppelt geschirmte Drähte verwenden. Achten Sie darauf, dass das geschirmte Netzwerkkabel nicht mit anderen Signalleitungen oder Gerätegehäusen in Berührung kommt und umwickeln Sie es mit Isolierband. Um Störungen zu vermeiden, sollte die Länge des Steuerkabels 50 m nicht überschreiten. Steuer- und Motorkabel müssen getrennt in separaten Kabelrinnen verlegt und so weit wie möglich voneinander entfernt sein. Falls sich die beiden Kabel kreuzen müssen, ist dies vertikal zu tun. Sie dürfen niemals in derselben Leitung oder Kabelrinne verlegt werden. Einige Anwender haben diese Vorgaben bei der Kabelverlegung jedoch nicht strikt befolgt. Dies führte dazu, dass die Geräte zwar bei der Einzelprüfung einwandfrei funktionierten, im laufenden Betrieb jedoch erhebliche Störungen verursachten und somit den Betrieb unmöglich machten.
Besondere Vorsicht ist auch bei der täglichen Wartung von Frequenzumrichtern geboten. Manche Elektriker schalten den Frequenzumrichter sofort zur Wartung ein, sobald sie einen Fehler feststellen und er auslöst. Dies ist sehr gefährlich und kann zu Stromschlägen führen. Denn selbst wenn der Frequenzumrichter nicht in Betrieb ist oder die Stromversorgung unterbrochen wurde, kann aufgrund der vorhandenen Kondensatoren noch Spannung an der Eingangsleitung, dem Gleichstromanschluss und dem Motoranschluss des Frequenzumrichters anliegen. Nach dem Ausschalten muss einige Minuten gewartet werden, bis sich der Frequenzumrichter vollständig entladen hat, bevor die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Manche Elektriker führen nach dem Auslösen des Systems sofort Isolationsprüfungen am vom Frequenzumrichter angetriebenen Motor mithilfe eines Rütteltisches durch, um festzustellen, ob der Motor durchgebrannt ist. Auch dies ist sehr gefährlich, da es leicht zum Durchbrennen des Frequenzumrichters führen kann. Daher dürfen vor dem Trennen des Kabels zwischen Motor und Frequenzumrichter weder am Motor noch am bereits angeschlossenen Kabel Isolationsprüfungen durchgeführt werden.
Besondere Aufmerksamkeit sollte der Messung der Ausgangsparameter des Frequenzumrichters gewidmet werden. Da das Ausgangssignal des Frequenzumrichters eine PWM-Wellenform mit Oberschwingungen höherer Ordnung ist und das Motordrehmoment hauptsächlich vom Effektivwert der Grundspannung abhängt, wird bei der Messung der Ausgangsspannung primär der Wert der Grundspannung mit einem Gleichrichtervoltmeter ermittelt. Die Messergebnisse stimmen am besten mit denen eines digitalen Spektrumanalysators überein und weisen eine ausgezeichnete lineare Beziehung zur Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters auf. Zur weiteren Verbesserung der Messgenauigkeit kann ein kapazitiver Filter eingesetzt werden. Digitale Multimeter sind störanfällig und weisen erhebliche Messfehler auf. Der Ausgangsstrom muss als Gesamteffektivwert einschließlich Grundwelle und Oberschwingungen gemessen werden. Daher wird üblicherweise ein Drehspulamperemeter verwendet (bei Motorlast ist der Unterschied zwischen dem Effektivwert des Grundstroms und dem Gesamteffektivwert vernachlässigbar). Aus Gründen der Messfreundlichkeit kann ein Stromwandler eingesetzt werden. Da dieser bei niedrigen Frequenzen in die Sättigung geraten kann, ist die Wahl eines Stromwandlers mit geeigneter Kapazität erforderlich.