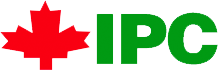Anbieter von Energierückkopplungsgeräten für Frequenzumrichter weisen darauf hin, dass in AC-Frequenzumrichter-Drehzahlregelungssystemen derzeit häufig einfache Bremsverfahren mit Energieverbrauch eingesetzt werden. Diese weisen jedoch Nachteile wie Energieverschwendung, starke Erwärmung durch den Widerstand und ein unzureichendes Schnellbremsverhalten auf. Bei häufigem Bremsen von Asynchronmotoren ist die Rückkopplungsbremsung eine sehr effektive Energiesparmethode, die Umweltschäden und Schäden an Anlagen während des Bremsvorgangs vermeidet. In Branchen wie Elektrolokomotiven und der Ölförderung wurden bereits zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. Mit der ständigen Entwicklung neuer Leistungselektronikgeräte, steigender Kosteneffizienz und dem wachsenden Bewusstsein der Bevölkerung für Energieeinsparung und Verbrauchsreduzierung eröffnen sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
Die Energierückkopplungsbremse eignet sich besonders für Anwendungen mit hoher Motorleistung (ab 100 kW), großem Trägheitsmoment gd² der Anlage und wiederholtem, kurzzeitigem Dauerbetrieb. Dabei ist eine starke Bremswirkung bei hoher Drehzahlreduktion, kurzer Bremszeit und hohem Bremsdruck erforderlich. Um die Energieeffizienz zu steigern und Energieverluste während des Bremsvorgangs zu minimieren, wird die Bremsenergie zurückgewonnen und ins Stromnetz eingespeist.
Rückkopplungsbremsprinzip
Im Drehzahlregelungssystem mit variabler Frequenz werden Verzögerung und Stillstand des Motors durch schrittweises Reduzieren der Frequenz erreicht. Mit sinkender Frequenz verringert sich auch die Synchrondrehzahl des Motors. Aufgrund der mechanischen Trägheit bleibt die Rotordrehzahl jedoch zunächst konstant, ihre Änderung weist eine gewisse Verzögerung auf. In diesem Moment ist die tatsächliche Drehzahl höher als die Solldrehzahl, wodurch die induzierte Gegenspannung e des Motors die Gleichspannung u des Frequenzumrichters übersteigt (e > u). Der Elektromotor fungiert nun als Generator und benötigt keine Netzstromversorgung mehr, sondern kann sogar Strom ins Netz einspeisen. Dies bewirkt nicht nur eine gute Bremswirkung, sondern wandelt auch kinetische Energie in elektrische Energie um, die zur Energierückgewinnung ins Netz eingespeist werden kann – zwei Fliegen mit einer Klappe. Selbstverständlich ist hierfür eine Energierückkopplungseinheit zur automatischen Steuerung erforderlich. Diese Energierückkopplungsschaltung sollte zudem AC- und DC-Drosseln, Widerstands-Kondensatoren, elektronische Schalter usw. enthalten.
Wie bekannt, ist die Brückengleichrichterschaltung herkömmlicher Frequenzumrichter dreiphasig und nicht steuerbar, wodurch ein bidirektionaler Energieaustausch zwischen Gleichstromkreis und Stromversorgung nicht möglich ist. Eine effektive Lösung bietet die aktive Wechselrichtertechnologie. Der Gleichrichterteil ist ein reversibler Gleichrichter, auch netzseitiger Wechselrichter genannt. Durch Ansteuerung des netzseitigen Wechselrichters wird die zurückgewonnene elektrische Energie in Wechselstrom mit der gleichen Frequenz und Phase wie das Netz umgewandelt und zur Bremsung ins Netz zurückgespeist. Bisher verwendeten aktive Wechselrichter hauptsächlich Thyristorschaltungen, die nur bei stabiler Netzspannung und geringen Netzspannungsschwankungen (maximal 10 %) sicher funktionieren. Diese Schaltungsart gewährleistet den sicheren Betrieb des Wechselrichters nur bei stabiler Netzspannung und geringen Netzspannungsschwankungen (maximal 10 %). Denn während der Bremsung der Stromerzeugung kann eine Bremszeit der Netzspannung von mehr als 2 ms zu Kommutierungsfehlern und Bauteilschäden führen. Darüber hinaus weist diese Methode bei tiefer Regelung einen niedrigen Leistungsfaktor, einen hohen Oberwellengehalt und überlappende Kommutierungen auf, was zu Verzerrungen der Netzspannungswellenform führt. Gleichzeitig ist die Regelung komplex und kostspielig. Mit der praktischen Anwendung vollgesteuerter Geräte wurden choppergesteuerte reversible Umrichter mit PWM-Steuerung entwickelt. Dadurch ist die Struktur des netzseitigen Wechselrichters identisch mit der des Wechselrichters, da beide die PWM-Steuerung nutzen.
Aus der obigen Analyse geht hervor, dass die Steuerung des netzseitigen Wechselrichters entscheidend für die erfolgreiche Energierückkopplungsbremsung des Wechselrichters ist. Im Folgenden wird der Steuerungsalgorithmus des netzseitigen Wechselrichters unter Verwendung vollständig gesteuerter Geräte und der PWM-Steuerungsmethode erläutert.
Kontrollalgorithmus
Der Regelalgorithmus für netzseitige Wechselrichter verwendet üblicherweise einen Vektorregelalgorithmus, wobei vdc, v * dc und △ vdc den Messwert, den Sollwert bzw. den Regelfehler der DC-Busspannung darstellen; id, i*d und Δ id den Messwert, den Sollwert bzw. den Regelfehler der d-Achse des netzseitigen Wechselrichters; iq, i*q und Δ iq den Messwert, den Sollwert bzw. den Regelfehler des q-Achsenstroms des netzseitigen Umrichters; Δ v * d, v * d und v * q die Sollwerte für die Abweichung der Ausgangsspannung der d-Achse, die Ausgangsspannung der d-Achse bzw. die Ausgangsspannung der q-Achse des netzseitigen Wechselrichters; EABC, V * ABC und IABC die momentanen Sollwerte des Netzpotenzials, der Ausgangsspannung des netzseitigen Umrichters bzw. des dreiphasigen Ausgangsstroms. φ repräsentiert die Amplitude bzw. die Phase des Gitterpotentials.
Der Vektorregelungsalgorithmus berechnet die Differenz zwischen der gemessenen Gleichspannung am Zwischenkreis und dem Sollwert und ermittelt den Sollwert des d-Achsenstroms mittels eines PI-Reglers. Anschließend wird, basierend auf der gemessenen Phase der Netzspannung, der gemessene Ausgangsstrom des netzseitigen Wechselrichters synchronkoordinatentransformiert, um die Messwerte des d-Achsenstroms und des q-Achsenstroms zu erhalten. Nach der PI-Anpassung wird der d-Achsenwert zur Amplitude der Netzspannung addiert, um die Sollwerte der d-Achsenspannung und der q-Achsenspannung zu erhalten. Nach der inversen synchronkoordinatentransformation wird das Ausgangssignal ausgegeben.
Der Vorteil dieses Algorithmus liegt in der hohen Regelgenauigkeit und dem guten dynamischen Verhalten; der Nachteil besteht darin, dass der Regelalgorithmus viele Koordinatentransformationen enthält und komplex ist, was eine hohe Rechenleistung des Regelprozessors erfordert.
Es verwendet eine PWM-Gleichrichterkonfiguration mit Stromnachführung. Dieser vereinfachte Algorithmus multipliziert den Sollwert des d-Achsen-Stroms direkt mit dem aus der Phasentabelle der gemessenen Netzspannung ermittelten dreiphasigen Sinus-Referenzwert, um den Sollwert des dreiphasigen Ausgangsstroms zu erhalten. Anschließend wird eine einfache PI-Anpassung durchgeführt, um den Sollwert der dreiphasigen Ausgangsspannung zu bestimmen und auszugeben. Da in diesem Algorithmus auf Koordinatentransformationen verzichtet wird, ist der Rechenleistungsbedarf des Regelprozessors relativ gering. Andererseits weist der PI-Regler aufgrund seiner Eigenschaften einen gewissen stationären Fehler in der Wechselstromregelung auf, wodurch der Leistungsfaktor dieses Algorithmus niedriger ist als der des Standard-Vektorregelungsalgorithmus. Während dynamischer Prozesse sind die Schwankungen der Zwischenkreisspannung relativ groß, und die Wahrscheinlichkeit von Zwischenkreisspannungsfehlern und anderen Fehlern während schneller dynamischer Prozesse ist relativ hoch.
Rückkopplungsbremscharakteristik
Streng genommen kann der netzseitige Wechselrichter nicht einfach als „Gleichrichter“ bezeichnet werden, da er sowohl als Gleichrichter als auch als Wechselrichter fungiert. Durch den Einsatz von Selbstabschaltvorrichtungen lassen sich Amplitude und Phase des Wechselstroms mittels geeigneter Pulsweitenmodulation (PWM) steuern. Dadurch nähert sich der Eingangsstrom einer Sinuswelle an und der Leistungsfaktor des Systems liegt stets nahe bei 1. Erhöht die vom Wechselrichter durch die Motorbremsung zurückgewonnene Energie die Gleichspannung, kann die Phase des Wechselstrom-Eingangsstroms gegenüber der Phase der Versorgungsspannung umgekehrt werden, um einen regenerativen Betrieb zu ermöglichen. Die zurückgewonnene Energie wird in das Wechselstromnetz eingespeist, während die Gleichspannung auf dem vorgegebenen Wert gehalten wird. In diesem Fall arbeitet der netzseitige Wechselrichter im aktiven Wechselrichterbetrieb. Dies ermöglicht einen einfachen bidirektionalen Leistungsfluss und eine schnelle dynamische Reaktionszeit. Gleichzeitig erlaubt diese Topologiestruktur die vollständige Steuerung des Austauschs von Blind- und Wirkleistung zwischen Wechsel- und Gleichstromseite mit einem Wirkungsgrad von bis zu 97 % und erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen. Der Wärmeverlust beim Bremsen beträgt 1 % des Energieverbrauchs und belastet das Stromnetz nicht. Der Leistungsfaktor liegt bei etwa 1, was umweltfreundlich ist. Daher eignet sich die Rückkopplungsbremsung hervorragend für energiesparende Betriebsabläufe in PWM-Wechselstromübertragungen, insbesondere bei häufigem Bremsen. Auch bei hoher Motorleistung ist die Energieeinsparung signifikant. Je nach Betriebsbedingungen beträgt sie durchschnittlich etwa 20 %. Der einzige Nachteil der Rückkopplungsregelung ist die komplexe Struktur des Regelsystems.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Energierückkopplungssystem gegenüber der Bremsung des Energieverbrauchs und der Gleichstrombremsung deutliche Vorteile bietet. Durch die Rückspeisung des erzeugten Stroms ins Netz mittels Rückkopplungsbremsung kann der Energieverbrauch gesenkt und die Stromkosten reduziert werden. Angesichts der aktuellen Stromknappheit infolge der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung in verschiedenen Teilen Chinas ist die Förderung und Anwendung von Rückkopplungsbremsen daher von großer Bedeutung für die Energieeinsparung.