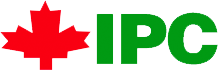Anbieter von Energierückkopplungsgeräten für Frequenzumrichter weisen darauf hin, dass in herkömmlichen Frequenzregelungssystemen mit Universal-Frequenzumrichtern, Asynchronmotoren und mechanischen Lasten der Motor bei sinkender Lastspannung in den regenerativen Bremszustand wechseln kann. Auch beim Abbremsen von hoher auf niedrige Drehzahl (z. B. beim Stillstand) kann die Frequenz abrupt abfallen, wobei der Motor aufgrund seiner mechanischen Trägheit in den regenerativen Energieerzeugungszustand eintritt. Die im Getriebe gespeicherte mechanische Energie wird vom Motor in elektrische Energie umgewandelt und über die sechs Freilaufdioden des Wechselrichters zurück in dessen Gleichstromkreis geleitet. Der Wechselrichter arbeitet dabei gleichgerichtet. Wird die Energie im Frequenzumrichter nicht genutzt, steigt die Spannung des Energiespeicherkondensators im Zwischenkreis an. Bei zu starkem Bremsen oder Hebezeugen kann diese Energie den Frequenzumrichter beschädigen. Daher sollte eine geeignete Energienutzung in Betracht gezogen werden.
Bei Frequenzumrichtern werden üblicherweise zwei Verfahren zur Nutzung der Rückgewinnungsenergie eingesetzt: (1) Ableitung über einen Bremswiderstand, der künstlich parallel zu einem Kondensator im Gleichstromkreis geschaltet ist (Leistungsbremsung); (2) Rückspeisung ins Stromnetz (Rückkopplungsbremsung, auch regenerative Bremsung genannt). Ein weiteres Bremsverfahren ist die Gleichstrombremsung (DC-Bremsung), die zum Einsatz kommt, wenn präzises Parken erforderlich ist oder der Bremsmotor vor dem Anfahren aufgrund äußerer Einflüsse unregelmäßig läuft.
Mit der Weiterentwicklung der Frequenzumwandlungstechnologie bieten die Konstruktion und Anwendung von Frequenzumrichterbremsen, insbesondere die neue Bremsmethode der „Energierückkopplungsbremse“, die Vorteile der „Rückkopplungsbremse“ und einer hohen Betriebseffizienz sowie die Vorteile der „Energieverbrauchsbremse“, die keine Verschmutzung des Stromnetzes verursacht und eine hohe Zuverlässigkeit aufweist.
Energieverbrauch beim Bremsen
Die Methode, bei der der Bremswiderstand im Gleichstromkreis zur Absorption der regenerativen elektrischen Energie des Motors eingesetzt wird, wird als energieverbrauchendes Bremsen bezeichnet. Sie bietet den Vorteil einer einfachen Konstruktion, verursacht keine Belastung des Stromnetzes (im Vergleich zur Rückkopplungsregelung) und ist kostengünstig. Der Nachteil besteht in der geringen Betriebseffizienz, insbesondere bei häufigem Bremsen, da hierbei viel Energie verbraucht und die Kapazität des Bremswiderstands erhöht wird.
Im Allgemeinen sind Frequenzumrichter mit niedriger Leistung (unter 22 kW) mit einer integrierten Bremseinheit ausgestattet, die lediglich einen externen Bremswiderstand benötigt. Frequenzumrichter mit hoher Leistung (über 22 kW) benötigen hingegen externe Bremseinheiten und Bremswiderstände.
Feedback-Bremsung
Um eine Energierückkopplungsbremsung zu erreichen, sind Bedingungen wie Spannungsregelung mit gleicher Frequenz und Phase sowie Rückkopplungsstromregelung erforderlich. Dabei wird aktive Wechselrichtertechnologie eingesetzt, um die zurückgewonnene elektrische Energie in Wechselstrom mit gleicher Frequenz und Phase wie das Stromnetz umzuwandeln und ins Netz zurückzuspeisen. Der Vorteil der Rückkopplungsbremsung liegt in der Verbesserung der Systemeffizienz durch die Rückkopplung elektrischer Energie. Zu den Nachteilen zählen: (1) Diese Methode kann nur bei stabiler Netzspannung ohne Fehleranfälligkeit (Netzspannungsschwankungen von maximal 10 %) angewendet werden. Denn während des Bremsvorgangs kann es bei einer Spannungsfehlerzeit im Stromnetz von mehr als 2 ms zu Kommutierungsfehlern und damit zu Bauteilschäden kommen. (2) Die Rückkopplung führt zu Oberschwingungen im Stromnetz. (3) Die Regelung ist komplex und kostenintensiv.
Neues Bremsverfahren (Kondensator-Rückkopplungsbremsung)
Die Energierückkopplungstechnologie nutzt IGBTs als Gleichrichterbrücke. Das IGBT-Funktionsmodul ermöglicht einen bidirektionalen Energiefluss und erzeugt mithilfe von Hochgeschwindigkeits-DSP-Chips PWM-Steuerimpulse. Zum einen kann die im Kondensator gespeicherte elektrische Energie ins Stromnetz zurückgespeist werden; zum anderen kann der Leistungsfaktor am Eingang angepasst werden, um Oberwellen im Stromnetz zu eliminieren.
Während des Stromverbrauchs erzeugt der DSP der Gleichrichtersteuereinheit sechs hochfrequente PWM-Impulse, um das Leiten und Sperren der sechs IGBTs auf der Gleichrichterseite zu steuern. Das Leiten und Sperren der IGBTs wirkt zusammen mit Drosseln, um eine sinusförmige Stromwellenform zu erzeugen, die mit der Phase der Eingangsspannung übereinstimmt. Dadurch werden die vom Gleichrichter erzeugten Oberschwingungen eliminiert und die Belastung des Stromnetzes mit Oberschwingungen vermieden.
Im Stromerzeugungszustand wird Energie über die Diode auf der Wechselrichterseite in den Zwischenkreis zurückgespeist. Mit zunehmender Energieansammlung steigt auch die Spannung im Zwischenkreis. Sobald ein bestimmter Wert überschritten wird, aktiviert sich die Energierückführung auf der Gleichrichterseite und wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um. Nach der Anpassung von Phase und Amplitude wird dieser zur Energieeinsparung in das Wechselstromnetz zurückgespeist.