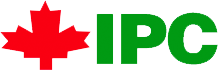Anbieter von Energierückkopplungsgeräten für Frequenzumrichter weisen darauf hin, dass in herkömmlichen Frequenzregelungssystemen mit Frequenzumrichtern, Asynchronmotoren und mechanischen Lasten der Motor bei sinkender Lastspannung in den Zustand der regenerativen Bremsung eintreten kann. Ebenso kann die Frequenz beim Abbremsen (z. B. beim Stillstand) abrupt abfallen, wobei der Motor aufgrund seiner mechanischen Trägheit Energie zurückgewinnt. Zur Nutzung dieser Energierückgewinnung gibt es zwei Methoden: die Widerstandsentladung und die inverse Rückkopplung. Letztere basiert auf einer „Dual-PWM“-Struktur mit vollständig gesteuerten Schaltelementen, deren hohe Kosten jedoch ihre breite Anwendung einschränken. Im Folgenden wird eine neue Methode zur Energierückgewinnung in Frequenzumrichtern vorgestellt.
Funktionsprinzip der Energierückkopplung
Die Rückführung der regenerativen Energie dient dazu, die vom Motor im regenerativen Bremszustand erzeugte, an beiden Enden des Filterkondensators gespeicherte elektrische Energie in das Stromnetz zurückzuspeisen. Als Rückkopplungsschaltung müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:
(1) Im Normalbetrieb des Frequenzumrichters ist die Rückkopplungseinrichtung nicht aktiv. Sie ist nur aktiv, wenn die Zwischenkreisspannung einen bestimmten Wert überschreitet. Sobald die Zwischenkreisspannung wieder auf den Normalwert absinkt, muss die Rückkopplungseinrichtung umgehend abgeschaltet werden, da sie sonst die Gleichrichterschaltung zusätzlich belastet.
(2) Der Rückkopplungsstrom des Wechselrichters sollte steuerbar sein.
Wechselrichterbereich
Die Thyristoren V1-V6 bilden einen dreiphasigen Brückenwechselrichter. Thyristoren zeichnen sich durch niedrige Kosten, einfache Ansteuerung, zuverlässigen Betrieb und ausgereifte Technologie aus. Da sie jedoch halbgesteuerte Bauelemente sind, muss der minimale Wechselrichterwinkel im Thyristoren-Wechselrichterkreis mindestens 30° betragen. Andernfalls kann es leicht zu Wechselrichterausfällen kommen, wodurch die normale Spannung des Zwischenkreises höher als die Wechselrichterspannung ausfällt. Der Wechselrichter kann durch Aussenden eines Triggerimpulses gestartet, aber nicht durch dessen Abschaltung gestoppt werden. Eine Abschaltung des Triggerimpulses während des Betriebs führt zu schwerwiegenden Wechselrichterausfällen. Daher muss der Wechselrichter durch Abschalten des Zwischenkreises gestoppt werden.
Die Funktion des Spannungswandlers (VT) ist zweifach: Zum einen steuert er das Ein- und Ausschalten des Wechselrichters. Beim Einschalten des VT wird die Gleichspannung an die Wechselrichterbrücke angelegt, um den Wechselrichter zu starten. Beim Ausschalten des VT wird der Gleichstromkreis unterbrochen und der Wechselrichter stoppt (in diesem Fall ist ein Triggerimpuls optional). Die normale Spannung des Zwischenkreises beträgt ca. 600 V (bei einer Netzspannungsschwankung von ± 10 %). Das Ein- und Ausschalten des Wechselrichters hängt von der Größe der Zwischenkreisspannung ab und erfolgt mittels Hystereseregelung. Liegt die Zwischenkreisspannung über 1,2 × 600 V, startet der Wechselrichter; liegt sie unter 1,1 × 600 V, schaltet er sich ab. Die zweite Funktion des VT ist die Steuerung der Wechselrichterstromstärke.
Steuerung des Wechselrichterstroms
Beim Umkehren der Drehrichtung sind die Zwischenkreisspannung und die Wechselrichterspannung parallel geschaltet und gleich gepolt, wobei die Zwischenkreisspannung höher als die Wechselrichterspannung ist. Die Induktivität L dient zum Ausgleich der Spannungsdifferenz. Die Ansteuerung des Spannungswandlers kann mittels PWM-Stromhystereseregelung erfolgen; diese Methode wird hier angewendet.
Wenn iL < I<sub>L-IL</sub>, leitet VT. Die Gleichspannung wird an die Induktivität L und die Wechselrichterbrücke angelegt, wodurch ein Strom im Pfad ① entsteht und der Strom iL ansteigt. Sobald iL den Wert I<sub>3</sub>L + IL überschreitet, schaltet VT ab, und der Strom durch die Diode D fließt weiter. Der Strom iL beginnt zu sinken. Wenn iL auf I<sub>3</sub>L - IL absinkt, leitet VT wieder, und iL steigt erneut an. Durch das Ein- und Ausschalten von VT wird der Wechselrichterstrom iL auf dem Sollwert I<sub>3</sub> gehalten. Unabhängig von Änderungen des Spitzenwerts der Wechselrichterspannung kann die Induktivität L dank der hochfrequenten Schaltsteuerung sehr klein gehalten werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für die Leitfähigkeit des VT zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen: (1) Die Gleichspannung Uc muss höher sein als die eingestellte obere Spannungsgrenze; (2) Der Wechselrichterstrom iL muss kleiner sein als die eingestellte untere Stromgrenze.
Die Abschaltung des VT sollte eine der folgenden beiden Bedingungen erfüllen: (1) Die Gleichspannung Uc ist niedriger als die eingestellte untere Spannungsgrenze; (2) Der Wechselrichterstrom iL überschreitet die eingestellte obere Grenze.
Um häufiges VT-Schalten zu vermeiden, wird für die Spannung Uc und den Strom iL eine Hystereseregelung verwendet, wobei die Schleifenbreite die Differenz zwischen der eingestellten oberen und unteren Grenze ist.
Berechnung der Induktivität
Um die Berechnung zu vereinfachen und die momentane Variation der Wechselrichterspannung Vd Β zu ignorieren, die als konstante Größe betrachtet wird, kann die folgende Gleichung erhalten werden: L diL dt=Uc Ud Β Die Lösung der Gleichung ergibt t1=2ILL Uc Ud Β, wobei IL die Stromhysteresebreite ist;
Uc – Gleichspannung; Ud Β – Durchschnittswert der Wechselrichterspannung.
Im t2-Intervall wird VT abgeschaltet und die Spannung fließt weiterhin durch D.
Es gilt folgende Gleichung: L diL dt = - Ud B Lösung: t2 = 2ILL Ud B Zerhackperiode: T = t1 + t2 = 2ILLUc Ud B (Uc Ud B) Zerhackfrequenz: f = Ud B (Uc Ud B) IILLUc Induktivität: L = Ud B (Uc Ud B) 2ILUCf. Die obige Gleichung zeigt, dass L sehr klein ist, wenn f sehr hoch ist. Dies unterscheidet sich von typischen Thyristor-Wechselrichterschaltungen. Die obige Formel kann als Grundlage für die Auswahl der Induktivität verwendet werden.
Berechnung des Kondensatorentladestroms
Nur wenn VT leitet, kann ein Entladestrom aus dem Kondensator fließen. Daher beträgt der Mittelwert des Entladestroms: Ic = t1 TI 3 L. Setzt man die obige Formel in die Formel für den Zerhackerzyklus ein, ergibt sich: Ic = Ud Β Uc I 3 L